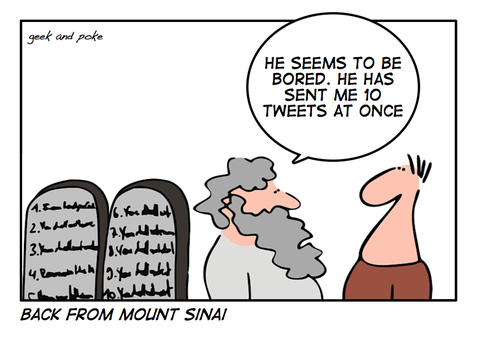Am letzten Donnerstag stand ich spätabends vor dem Kühlschrank und überlegte, ob ich noch ein Bier trinken sollte. Ich hatte Bierdurst, aber ich war auch müde, es war schon spät und am Freitag musste ich wieder früh raus. Spätabends noch ein Bier zu trinken ist eine Gewohnheit von mir. Zwar nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig trinke ich abends noch ein Bier. Fast fehlt schon etwas, wenn ich keines trinke.
An diesem Abend war ich nicht sicher, ob es gut wäre, noch ein Bier zu trinken. Irgendwie ahnte ich schon, dass es mir am nächsten Morgen nicht gut gehen würde. Trotzdem griff ich zur Flasche, öffnete sie und trank sie aus. Es schmeckte gut, und ich ging ins Bett. Prompt hatte ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen. Und nicht nur am Morgen, sondern auch am Vormittag und sogar mittags noch, obwohl ich eine Kopfschmerztablette genommen hatte.
Es war also nicht gut, noch ein Bier zu trinken. Eigentlich war dagegen ja nichts einzuwenden gewesen. Warum sollte ich am Ende eines langen Tages nicht eine Flasche Bier trinken? Es ist vielleicht nicht direkt mein Recht, aber jedenfalls liegt dieses Bier im Rahmen meiner persönlichen Freiheit.
Nun hatte mir diese Entscheidung allerdings geschadet. Ich hatte zwar meine Freiheit in Anspruch genommen, ich hatte mich mehr oder weniger frei entschieden, noch ein Bier zu trinken. Doch dieses eine, an sich harmlose Bier war von Übel. Das merkte ich am nächsten Tag.
Meine Freiheit ist also eine zweischneidige Sache. Sie ist einerseits gut und richtig und wichtig. Die Freiheit gehört zum Menschsein dazu. Aber ich kann meine Freiheit offensichtlich auch falsch einsetzen und mir damit schaden.
Der jüngere Sohn im Gleichnis, das wir heute in der Heiligen Messe gehört haben, erlebt genau dies. Er nimmt seine Freiheit in Anspruch, und der Vater gewährt sie ihm. Er zahlt ihm sein Erbteil aus, obwohl er vermutlich ahnt, was sein Sohn vorhat. Der zieht hinaus in die Welt und haut sein Erbe auf den Kopf.
Er will einfach genießen. Er will das Leben ausschöpfen bis zum Äüßersten, „Leben in Fülle“ haben, wie er meint. Er will keinem Gebot, keiner Autorität mehr unterstehen: Er sucht die radikale Freiheit; er will nur sich selber leben, keinem anderen Anspruch unterstellt. Er genießt das Leben; fühlt sich ganz autonom. (Joseph Ratzinger, Benedikt XVI.: Jesus von Nazareth. Erster Teil, 243f.)
Doch seine Autonomie hat Grenzen. Es dauert nicht lange, bis das Erbe verbraucht ist. Ohne Geld ist er nicht mehr frei, im Gegenteil: Er wird zum Knecht, muss Schweine hüten und wäre froh, wenn er selbst Schweinefutter zu essen bekäme. Für Juden sind Schweine unreine Tiere. Der Sohn, der zum Knecht geworden ist, schließt sich also selbst aus der Gemeinschaft aus. Er ist ein Sklave und alles andere als frei.
An diesem Punkt ist die Freiheit in ihr Gegenteil umgeschlagen – in die völlige Unfreiheit, in die Knechtschaft. Der an sich freie Mensch hat sich gegen den Vater entschieden, ist seine eigenen Wege gegangen und endet als Knecht bei den Schweinen. Für diesen Zustand der Unfreiheit, der Abwendung von Gott, dem Vater gibt es ein altes Wort: Es lautet Sünde.
Doch an diesem Punkt kehrt der verlorene Sohn um. Seine Suche nach Freiheit hat ihn in eine Sackgasse geführt. Ihm bleibt keine andere Wahl als umzukehren, wenn er nicht dort bleiben will, wo er ist. Er kehrt zurück zum Vater, und man könnte diese Rückkehr für eine Niederlage halten. Tatsächlich aber ist sie ein Sieg, und zwar ein Sieg über das Böse. Der Sohn hat sich nicht nur vom Vater abgewandt, als er in die Fremde zog. Er hat sich von sich selbst entfernt, als er versucht hat, sich selbst zu verwirklichen. Mit den finanziellen Mitteln seines Vaters übrigens, und die waren offensichtlich nicht unbegrenzt.
Der Sohn kehrt also zum Vater zurück, und zugleich auch zu sich selbst. Der Vater freut sich, nicht weil er irgendwie Recht behalten hätte, sondern weil er seinen Sohn wiedergefunden hat:
Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. (Lk 15,24)
Schauen wir kurz auf den größeren Zusammenhang. Jesus erzählt hier insgesamt drei Gleichnisse, und er antwortet damit auf den Vorwurf von Pharisäern und Schriftgelehrten, dass er sich mit Sündern abgibt und sogar mit ihnen isst. Wie die Schweine als unreine Tiere gelten denen die Sünder als unreine Menschen, mit denen man sich nicht abzugeben hat.
Jesus sieht das anders. Im Markusevangelium sagt er auf den gleichen Vorwurf hin:
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. (Mk 2,17b)
Jesus wendet sich an die Sünder, nicht weil er die Sünde irgendwie kleinreden oder gutheißen will, sondern um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Das ist sein Programm, dem er bis zum Äußersten treu bleibt. „Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat“ Jesus Christus „uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit“, heißt es in einer Präfation.
Die Umkehr eines Sünders ist deshalb ein Grund zur Freude – Gott hat sein Ziel erreicht. In allen drei Gleichnissen steht am Ende die Freude über den Sünder, der umkehrt:
Freut euch mit mir; ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren. (Lk 15,6b-7)
Und:
Freut euch mit mir; ich habe die Drachme wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch: Ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. (Lk 15,9b-10)
Der Sünder, der umkehrt, das ist der Mensch, der sich vom Vater abgewandt hatte und nur noch sich selbst zum Maßstab nehmen wollte. Der damit scheitert und sein Scheitern erkennt. Der es bereut und zum Vater zurückkehrt. Und der vom Vater mit offenen Armen empfangen wird. Das ist die gute Nachricht: Gott empfängt den Sünder, der umkehrt, mit offenen Armen.
Doch was ist mit dem älteren Bruder? Im Unterschied zum jüngeren hat er nie gegen den Willen seines Vaters gehandelt. Er ist mit Gott im Reinen, er hält sich an seine Gesetze. Er ist kein Sünder. Aber nun empört er sich, wie es auch die Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus tun, über die Großzügigkeit seines Vaters.
Er hat seine Freiheit nicht so in Anspruch genommen, wie es sein jüngerer Bruder tat. Er ist nicht in die Ferne gezogen und hat nicht sein Erbteil durchgebracht, sondern dient schon viele Jahre seinem Vater, und nun klagt er über eine fehlende Belohnung für diesen Dienst. Auch er ist nicht wirklich frei. Er trägt seine „Freiheit eigentlich doch als Knechtschaft“ (Ratzinger, a.a.O., 252) und hat den Weg zur wahren Freiheit noch vor sich.
Er hält sich an die Gesetze, wie es auch die Pharisäer und Schriftgelehrten tun, und damit macht er sicher keinen Fehler. Aber Gott ist größer als das Gesetz. Die Bekehrung des älteren Bruders ist die Umkehr vom Gott des Gesetzes zum Gott der Liebe. Gott hat seinen Sohn gesandt, heißt es im Galaterbrief, „damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen“ (4,5). Auch der ältere Sohn muss umkehren. Er muss seine Bitterkeit ablegen und sich mit dem Vater freuen über seinen Bruder, der tot war und wieder lebt, der verloren war und wieder gefunden wurde.