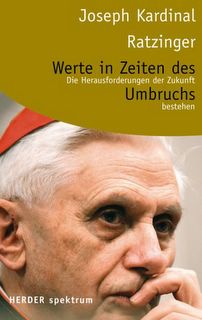Ist der Zulauf, den die katholische Kirche in den vergangenen Wochen hatte, also nur ein Pyrrhussieg – um den Preis ihrer dogmatischen Aushöhlung?
Kommt drauf an. Das Projekt der katholischen Kirche ist es, möglichst viele Menschen unter ihr Dach zu bringen. Dazu sind ihr alle Mittel recht. Denken Sie nur an den Papst – was hat ihn berühmt gemacht? Er flog in der Welt rum, warf sich auf den Boden, küsste die Erde. Worum es ihm also ging, war die Sichtbarkeit der Kirche. So gesehen, hat der Papst gezeigt, wie immun die katholische Kirche gegen die Erosion der Dogmen ist.
Gleichzeitig verlieren die Kirchen, zumindest in Deutschland, immer mehr Gläubige.
Das bedeutet noch nichts. Es gibt ja auch immer weniger Leute, die in Vereinen Sport treiben. Aber das heißt nicht, dass Sport an Attraktivität einbüßt. Man betreibt ihn nur anders: auf eigene Faust, spontan – oder im Rahmen eines Events. Deshalb wird Religiösität dort gewinnen, wo sie als Massenveranstaltung fasziniert – beim Begräbnis des Papstes zum Beispiel.
Zeigt die weltweite Trauerdemo aber nicht, dass Religion keineswegs verschwunden ist, wie uns viele glauben machen wollten?
Kant hatte sicher Recht, dass alle Menschen ein metaphysisches Bedürfnis haben. Offensichtlich haben die Enttäuschungserfahrungen mit den großen säkularen Heilsversprechen dieses Bedürfnis nicht ausgetrieben, sondern es im Gegenteil anwachsen lassen: Je weniger es erfüllt wird, umso stärker wächst es. Einige dieser Heilsversprechen haben wir ja ausprobiert: die völkischen Ideologien, den Sozialismus, die Naturidolatrie der Grünen. Modernität bedeutet nichts anderes als enttäuscht zu werden bei diesen Projektionsversuchen. Und das Heilsversprechen der Religion liegt darin, uns den Preis der Modernität zu ersparen.
Sie glauben, das metaphysische Bedürfnis kehrt auf diese Weise zurück zu seinem Ausgangspunkt?
Das metaphysische Bedürfnis kehrt zurück zur Religion als dem klassischen Thesaurus des Sinns. Allerdings sind wir zu modern, zu klug, zu aufgeklärt, um uns nur eine einzige Antwort bieten zu lassen. Eben deshalb bleibt Religion ja dem Numinosen verhaftet: als Geheimnis, das Angst macht und fasziniert.
Heißt das, dass die mit der Aufklärung und Säkularisierung verbundene Hoffnung, angstfrei in eine bessere Zukunft zu gehen, gescheitert ist?
Allerdings. So werden vorwissenschaftliche Angebote der Entängstigung wieder attraktiv. Für Philosophie und Wissenschaft bedeutet das, auf alle Wahrheitsansprüche verzichten zu müssen. Es ist eine der wichtigsten Einsichten der letzten Jahrzehnte, dass wir es nicht mit einem Werteverlust zu tun haben, sondern mit einem Werteverzicht, nicht mit einem Sinnverlust, sondern einem Sinnverzicht. Nur: Wem kann man so was zumuten? Max Weber hat vor 100 Jahren gesagt, was es dazu bräuchte – bitte lachen Sie nicht: ‚gereifte Männlichkeit‘. Das ist es. ‚Wer es nicht erträgt‘, so Weber, ‚der kehre in die weit geöffneten Arme der katholischen Kirche zurück.‘
Also brauchen wir die Religion als Ordnungs- und Solidaritätsfaktor?
Im Wortsinn von religio – Bindung und Rückbindung – ja.
Jürgen Habermas, unser Chefaufklärer, hat ja schon die postsäkulare Gesellschaft ausgerufen. Und Ralf Dahrendorf hat den Begriff der Ligaturen geprägt. Das ist ja nur ein anderes Wort für religio: Verknüpfungen, Verbindungen, Sicherheitsleinen. Dahinter steht die Einsicht, dass die Menschen ihrem eigenen Denken nicht gewachsen sind.
Zur Ironie der Aufklärung gehört es, dass sie die Metaphysik unter Spannung hält?
Ganz bestimmt. Wir wissen, dass die Sonne nicht aufgeht. Aber was soll’s? Für mich geht die Sonne eben doch auf. Das führt im Übrigen dazu, dass prominente Physiker wieder religiös werden. Das müsste eigentlich überraschen, tut es aber nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt keinen Konflikt zwischen Wissenschaft und Alltag, sondern, viel schlimmer: eine Beziehungslosigkeit. […] Die Kirche muss sich darüber klar werden, dass viele Lebensfragen von der Politik so wenig beantwortet werden können wie von der Wissenschaft – darin liegt ihre Chance. Die Leute kommen ihr ja bereits entgegen. Sie spüren, dass sie die Wahrheit nicht in Politik und Wissenschaft finden – und auch nicht in sich selbst. Dorthin hat man ja die Wahrheit zuletzt geschickt: in die Selbstverwirklichung. Doch im Selbst, das hat sich herausgestellt, ist eben auch nichts los.
Bleibt also nur die fröhliche Flucht in den Kult der Religion?
Es war jedenfalls die Illusion des Kulturprotestantismus, dass man keine Religion mehr braucht. Länder, die darauf verzichten, wie die Niederlande oder Schweden, betreiben eine Art Kulturpuritanismus, den ich für viel unangenehmer halte als den religiösen Puritanismus. Da werden Vorstellungen von einer guten Gesellschaft gepflegt, die so gut ist, dass mir sofort klar wird: Da möchte ich auf keinen Fall leben.