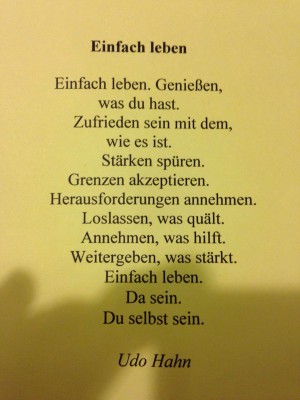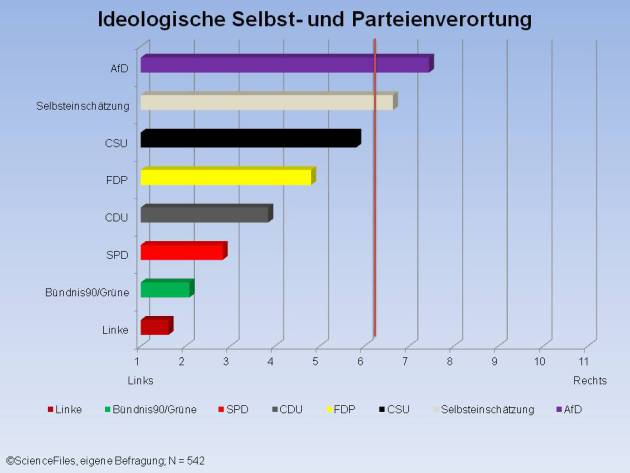Als Katholik glaube ich ja nicht an die Demokratie. Deshalb kann ich mir auch andere Regierungsformen vorstellen. Als Politikwissenschaftler staune ich allerdings über die Stabilität der Nachkriegsdemokratie in Deutschland. Die bisherigen großen Verwerfungen (1968/77 und 1989/90) hat sie gut verarbeitet, und auch für die Verarbeitung der Verwerfung von 2015ff. stehen die Chancen gut.
Die Briten jedoch bewundere ich für die Stabilität ihres politischen Systems, das schon so einiges weggesteckt hat. Ich denke, dass diese Stabilität auch mit der Monarchie zu tun hat. Die Queen symbolisiert quasi die Einheit des Königreiches in Raum und Zeit. So ein EU-Referendum ist angesichts der britischen Geschichte nicht viel mehr als eine Fußnote.
Den britischen Wählern, jedenfalls einem signifikanten Teil jener 52 Prozent, die sich für den Brexit ausgesprochen haben, wird nun vorgeworfen, in Unkenntnis wichtiger, entscheidungsrelevanter Fakten entschieden zu haben. Was sind denn das, einmal abgesehen von den hinlänglich bekannten und diskutierten Zahlungen an die EU, für Fakten, deren Kenntnis die britischen Wähler vermissen ließen, die aber unbedingt hätten bekannt sein müssen?
Geht es um mehr oder weniger detaillierte Kenntnisse des politischen Systems der EU? An diesem System lässt sich völlig zu Recht bemängeln, dass es an einer wirklichen Gewaltenteilung fehlt. Europäische Legislative und Judikative sind unterentwickelt, die Exekutive wird von den Regierungen der Mitgliedsstaaten dominiert. Das lässt nach wie vor viel zu wünschen übrig. Demokratiedefizit lautet seit Jahrzehnten das Stichwort.
Die europäische Währung ist in der Summe kein Erfolgsprojekt, und Großbritannien ist daran ebenso wenig beteiligt wie an Schengen. Die beiden wirklichen Erfolgsprojekte, Schengen und der Binnenmarkt, sind beide nicht an eine EU-Mitgliedschaft gebunden. Großbritannien wird auch nach dem Austritt Teil des Europäischen Wirtschaftsraumes bleiben.
Ich komme immer wieder auf die Nettozahlereigenschaft Großbritanniens zurück. Die Leave-Kampagne hat hier offensichtlich einen Nerv getroffen, das zeigen die zahlreichen bellenden Hunde. Übrigens ist das auch ein echtes Problem für die EU, denn wer soll eigentlich die nach einem Brexit fehlenden Mittel aufbringen? Oder muss etwa der EU-Haushalt massiv gekürzt werden?
Die EU müsste mal erklären, wozu sie eigentlich gut ist. Dies scheint vielen EU-Bürgern nicht mehr so recht einleuchten zu wollen. Bei Lichte besehen ist es eher erstaunlich, dass immerhin 48 Prozent der britischen Wähler in der EU bleiben wollten.